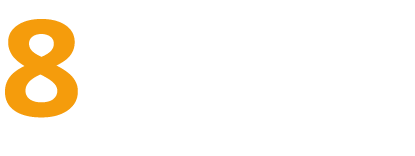Interview mit Manuel Barowsky (NextGen)

Interview mit WBW-Mitglied Dr. Marcus Lindner
4. März 2025Interview mit Manuel Barowsky (NextGen)

Wie Waldbesitzende den Wald zukunftsfest machen – NextGen-Vorstand Manuel Barowsky im Interview mit Wald ist Klimaschützer über Pflege, Klimaschutz und politische Rahmenbedingungen.
„Wer Wald klug und generationenübergreifend bewirtschaftet, trägt entscheidend zum Klimaschutz bei – und braucht dafür die Unterstützung der Gesellschaft.“
Der Wald spielt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Klimakrise – als Arbeitsplatz, Lebensraum, nachhaltiger Rohstofflieferant und CO₂-Pumpe. Gleichzeitig steht er unter zunehmendem Druck: Hitze, Trockenheit, Schädlinge und Stürme setzen ihm stark zu. Damit er seine vielfältigen Funktionen auch in Zukunft erfüllen kann, braucht es gezielte Pflege, politische Rückendeckung und ein breites Verständnis innerhalb der Öffentlichkeit über die Bedeutung unseres Klimaschützers Nr. 1.
Gerade im Frühjahr ist für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer viel zu tun, um die Weichen für einen gesunden, klimastabilen Wald zu stellen – von Pflanzungen über Pflegearbeiten bis hin zum Borkenkäfermonitoring. Im Interview erklärt Manuel Barowsky, Mitglied im Vorstand der NextGen, der Jugendorganisation der Familienbetriebe Land und Forst, sowie Mitgründer der Förderberatung arboreo, was jetzt konkret im Wald passiert. Außerdem erzählt er uns, welche Herausforderungen im und für den Wald bestehen und warum nachhaltige Bewirtschaftung und politische Rahmenbedingungen entscheidend sind, um den Wald als Klimaschützer langfristig zu erhalten.
Wald ist Klimaschützer (WiK): Der Wald hat für viele Menschen eine besondere Bedeutung. Was bedeutet der Wald für Sie persönlich? Gibt es besondere Erlebnisse oder Momente im Wald, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
Manuel Barowsky (MB): Für mich ist der Wald ein wunderbares Ökosystem, Arbeitsplatz, Wirtschaftsgut, Rückzugsort und Kraftquelle zugleich. Ich bin mit dem Wald aufgewachsen. Schon als Kind habe ich dort viel Zeit mit meinem Vater verbracht – beim Pflanzen, Bau von Wildschutzzäunen, Brennholz machen, später dann bei der Jagd, im Studium oder einfach beim sonntäglichen Spaziergang am Nachmittag. Diese Erfahrungen haben meinen Blick auf den Wald geprägt: als einen Ort, der nicht nur Ruhe und Erdung schenkt, sondern auch Verantwortung bedeutet.
WiK: Der Wald hat viele verschiedene Funktionen. Welche Rolle spielt der Wald aus Ihrer Sicht in unserer Gesellschaft – und wie könnte diese Rolle gestärkt werden?
MB: Der Wald ist ein echtes Multitalent – er verbindet Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte. Er liefert nicht nur den nachhaltigen Rohstoff Holz, sondern speichert CO₂, schützt Böden und Gewässer und bietet Lebensraum für zahlreiche Arten. Gleichzeitig ist er für viele Menschen ein Ort der Erholung – gerade in einer zunehmend urbanisierten Welt. Damit der Wald diese Funktionen auch in Zukunft erfüllen kann, braucht es mehr gesellschaftliche Wertschätzung und politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Bewirtschaftung. Es geht darum, den Wald nicht nur zu schützen, sondern ihn klug und generationenübergreifend zu gestalten.
WiK: Am 20. März war kalendarischer Frühlingsanfang. Welche konkreten Arbeiten und waldbaulichen Maßnahmen stehen jetzt in unseren Wäldern an?
MB: Die Pflanzung ist in den letzten Zügen, bevor es zu warm und trocken wird – junge Bäume müssen gesetzt werden, um klimastabile Mischwälder aufzubauen und um die Naturverjüngung ergänzend zu unterstützen. Daneben starten bald Pflegearbeiten wie das Freistellen junger Kulturen, damit sie sich gut entwickeln können, und die Kontrolle auf Wildverbiss. In vielen nadelholzdominierten Betrieben beginnt mit den ersten warmen Frühlingstagen bereits an vielen Stellen das Borkenkäfermonitoring um frühzeitig Befallsherde festzustellen und das Käferholz zu entnehmen, bevor weitere Teile des Waldes betroffen werden.
Wald als Klimaschützer ist „Interesse der Gesamtgesellschaft“
WiK: Der Klimawandel stellt die Forstwirtschaft vor große Herausforderungen – insbesondere bei der Wiederbewaldung und der Anpassung an neue klimatische Bedingungen. Welche waldbaulichen Strategien sind aus Ihrer Sicht notwendig, um den Wald fit für die Zukunft zu machen?
MB: Der Klimawandel zwingt zum Umdenken – selbst stabil geglaubte Buchenwälder kämpfen mit dem Extremklima. Das Ziel sind Waldstrukturen, die auch mit Extremwetter, Trockenheit und neuen Schädlingen zurechtkommen. Dazu gehört, auf Baumartenvielfalt zu setzen – sowohl heimische als auch ergänzend klimatolerantere Arten. Jede Fläche ist anders, deshalb braucht es fundierte Standortkenntnis und langfristige Planung. Forschung, digitale Tools und neue Erkenntnisse aus der Waldgenetik unterstützen uns dabei. Gleichzeitig brauchen wir flexiblere Rahmenbedingungen und eine Politik, die das Engagement der Waldbesitzenden stärkt und fördert, da intakte Wälder im Interesse der Gesamtgesellschaft sind.
WiK: Der Wald wirkt als CO₂-Pumpe und ist damit unverzichtbar im Kampf gegen die Klimakrise. Welche politischen Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um die Klimaschutzfunktion des Waldes langfristig zu erhalten und zu stärken?
MB: Wenn wir den Wald als natürlichen Klimaschützer erhalten wollen, müssen wir seine nachhaltige Bewirtschaftung politisch und finanziell absichern. Dazu gehört vor allem, die Klimaschutzleistung des Waldes und der Waldbewirtschaftung angemessen zu honorieren – etwa durch eine CO₂-Prämie oder gezielte Förderprogramme für klimastabile Wälder. Erste Schritte wurden hier bereits unternommen. Gleichzeitig braucht es weniger Bürokratie und mehr Handlungsspielraum für die Praxis. Viele junge Waldbesitzende sind bereit, Verantwortung zu übernehmen – aber sie benötigen verlässliche Rahmenbedingungen, die langfristiges Denken und Investieren ermöglichen. Dazu zählen zum Beispiel einfachere Genehmigungsprozesse und der Ausbau forstlicher Förderberatung. Einen konkreten Beitrag dazu haben wir mit der Gründung der Förderberatung arboreo geleistet. Über das hier entstehende Netzwerk unterstützen wir bundesweit Waldbesitzende in genau diesem Themenkomplex – theoretisch und praktisch im Wald von morgen.
WiK: Vielen Dank für das Interview!